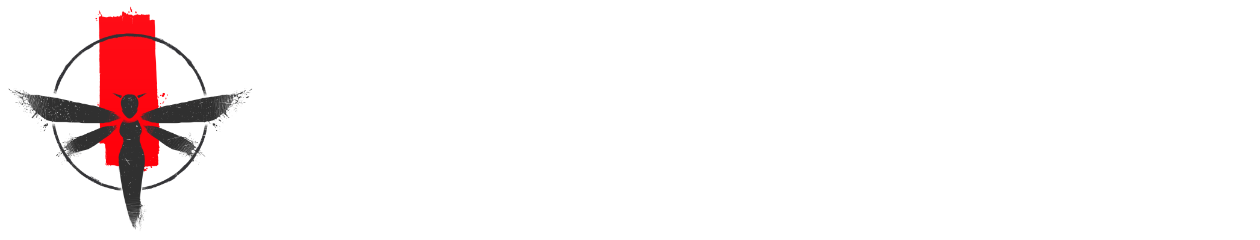Ich habe begonnen, Menschen zu umarmen. Damit meine ich weder meine Eltern, die ich liebe, noch Männer, die ich liebe. Ich habe begonnen, die sogenannten Freunde zu umarmen. Und ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Die Distanz, die ich gewohnt bin, schmilzt. Einerseits ist eine Umarmung oft ein probates Mittel, kurz und bündig auszudrücken, was in Worten leicht verloren geht. Andererseits ist eine Umarmung eine sehr barbarische Vernichtung des schönen und subtilen Austauschs von Blicken, den ich kenne und liebe.
Umarmungen laufen auch schnell Gefahr, in hauchfeine Heuchelei abzudriften. Dorthin möchte ich mich, auch nicht schleichend, bewegen. Dabei ist es sehr leicht, den Konventionen des Abschiedsrituals fast willenlos zu folgen. Ganz so schlecht fühlt es sich ja nicht an. Und manchmal will ich auch wirklich umarmen und umarmt werden. Aber eben nicht immer, nicht aus Gewohnheit, nicht aus Höflichkeit und nicht aus Faulheit, subtilere Gesten zu achten. Berührt werden möchte ich nur dann, wenn ich wirklich berührt bin. Oder es gute Gründe dafür gibt.
Vielleicht habe ich auch nur begonnen, die Menschen mehr zu lieben. Aber das, mit Verlaub, wäre ein wirklich schmaler Argumentationsgrat. Oder ich bin offener fürs Konventionelle geworden. Was nicht an sich verteufelt werden könnte.
Ein bisschen ratlos gehe ich in die Nacht. Was schön ist zu wissen: Jede neue Begegnung wird ohnehin für sich entscheiden, ob sie eine Umarmung werden will oder nicht.