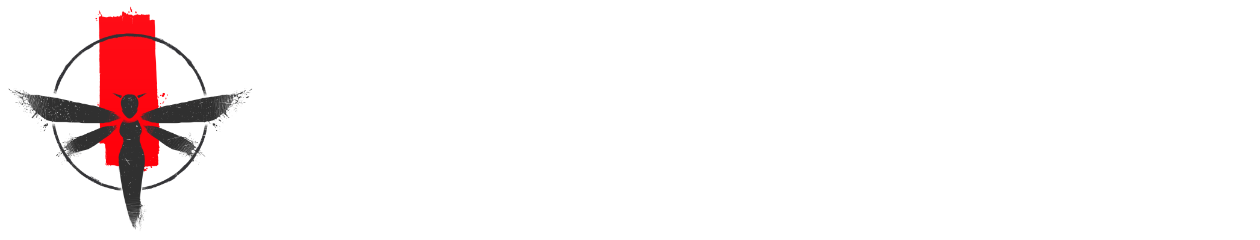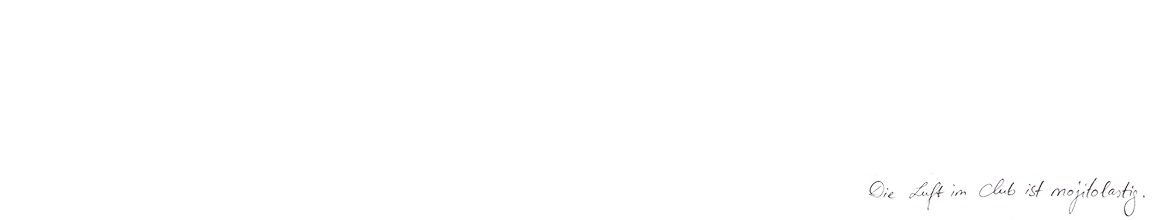Ich komme nach Hause, klappe den Koffer auf, Klamottenlasagne, räume nicht auf. Noch bin ich nicht messekrank geworden, obwohl ich Sibylle Bergs Handdesinfektionsgel abgelehnt habe. Oder gerade weil. Ich will eins von den Kindern sein, die mit Dreck spielen, alles anfassen und genau deshalb niemals krank werden. Vielleicht kostet mich dieses Wollen mal Kopf und Kragen.
In Frankfurt höre ich einen Penner schnarchen, so laut und dröhnend, als trage er einen riesigen Hohlraum in sich. Eine Brustkorbgrotte, die eigentlich in keinen Menschen passt, die große Leere. In mir, als ich auf die Straßenbahn warte, ist es ganz anders, ganz voll, dicht gedrängt, das Glatte, das Stopplige, das Perlige, das Flauschige, das Knistrige, das Knackige, das große Bunte. Fast zu gedrängt, schon im Mainnizza droht leichtes Durcheinandergeraten, ein Schluck Fleisch, ein Bissen Fanta.
Für die nächsten drei Wochen kann ich keine dicken Hipsterhornbrillen mehr sehen. Entferne Kugelschreiberlinien von meinen Schuhen mit dem Aggressivsten, was ich im Haus finde, mit siebzigprozentigem Absinth. Das Rascheln von Maispflanzen, ein neues Lieblingsgeräusch, ein Herbstlaut, Erntezeitwispern. Alles ist in Bewegung. Den Holzbalken nicht so betrachten, als sei seine graue Stämmigkeit für immer, denke ich und stoße mir den Kopf daran. Windmühlenreiter. Trotzkind.