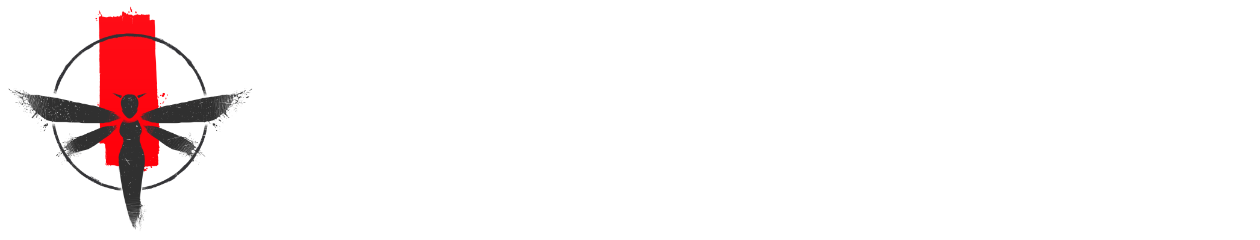Auf meinem Becher steht, in einer Schreibmaschinenschrift, das Wort Kaffe. Mit einem e, weil Schwedisch. Eine eigene Tasse gehört zum Mindestumfang eines Exilhaushalts wie diesem. Während ich trinke, frage ich mich, was es mit Kaffee so Bedeutungsvolles auf sich hat. Jeder redet über ihn, gern und oft. Ich schlürfe und esse einen Muffin von mörderischem Umfang. Pausenbloggerei. Draußen quasseln die Möwen.
Hinterm Wohnblock liegt ein kleiner Sandstrand. Er ist ruhig und umschlossen von Räubertochterwald, grünes Wasser, heller Sand, grüne Krautschicht, weiße Buschwindröschen. Schon zweimal saß ich dort, auf einem Stein oder die Hände im Sand vergraben, und wuchs für eine halbe Stunde fest. Mit dem Wind beginnt es nach Meer zu riechen. Ich könnte tagelang durch den Räubertochterwald laufen, meine Füße sind für Pfade gemacht, für Abhänge und Gräben, Wurzeln, Fels, Moos, fühlen sich beim Laufen wie kleine Hufe an. Im Schilf flüstern die Wellen. Der Eichelhäher beobachtet mich tunlichst, hüpft um mich herum, schreit aber keinen Alarm. Er weiß es: Die gehört dazu.
Vor dem Fenster vermählen sich zwei Bäume, ein toter und ein lebendiger. Die Möwen pöbeln immer noch durch den Himmel. Plötzlich fährt bimmelnd ein Eiswagen vor.
Instantkaffee
Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel Sushi zum Frühstück esse, sonst werde ich arm. Außerdem macht mich der Instantkaffee ganz zappelig. Aber es trinkt sich so gut, heiß und viel zu schwarz, sogar mit Milch noch dunkel. Ist schon jemand an Instantkaffee gestorben?
Zerfleddert
Die Stockholmer Dozentin, die Heidegger lehrt, ist jung, schwarz gekleidet und zeigt ein ländliches Gesicht. Wäre ihr sehr kurzes Haar nicht blond gefärbt, passte der Heideggersche Krug sehr gut in ihre feste Hand. Stattdessen spricht sie von Faktizität, Existenz, Verfallen, stockt dabei manchmal, lächelt, spricht schnell, bricht ab, spricht schneller, spricht zum Fenster hin, lächelt und sammelt die Studenten wieder mit einem Blick ein. Ich mag es, sie zu hören, zu sehen. Ihre Stimme ist zu kehlig für meinen Geschmack, aber diese Sprechart fiel mir bei etlichen Schwedinnen auf.
Leicht pervers fühlt es sich schon an, den Deutschen auf Schwedisch zu studieren, aber weil ich seine Texte gut kenne, mischt sich jedesmal die Neugier dazwischen, wie dies oder jenes übersetzt wurde, wie dies oder jenes in der nordischen Sprache klingt. Und, zugegeben, von Deutsch nach Schwedisch, das ist eine milde und sehr machbare Übersetzung.
Auf dem Pult der Dozentin liegt eine zerfledderte, gebundene Ausgabe auf Deutsch. Niemeyer, Tübingen.
Chinesisches Lächeln
Ich wohne praktisch mitten im Naturpark. Ein erster, langer Spaziergang trägt mich stundenlang durch Wälder, über weiche Pfade, an allen Wassern entlang. Sie sehen aus wie große Seen und sind doch irgendwie das Meer. Sie sind überall, teilen und begrenzen völlig frei, wie es ihnen gefällt. Hier und dort ist nicht dasselbe. Manchmal braucht es eines großen Wassers, um diese Einfachheit zu begreifen. An Gärten und Villen vorbei, an Teichen, unter den Augen von Gans und Buntspecht, an Felsrücken, die grün und grau und glatt zum Berühren einladen, an Moos und Brücken.
Später, Cornflakes, Tee und Kaffee kaufen, Milch nicht vergessen, dann Deutsche, Asiaten und Schweden auf dem Flur treffen. Langsam weicht auch das Gefühl, dass ich etwas Verbotenes tue, wenn ich die fremde, große Küche benutze, meine Milch in die fremden Kühlschränke stelle, aus fremden Tassen trinke. Langsam wird das Stockwerk mein Zuhause. Ich treffe drei Chinesinnen und beschließe, dass ich sie mag. Sie haben sich englische Namen ausgesucht, damit niemand ihre chinesischen Namen aussprechen muss. Wir essen gemeinsam und ich mag sie immer noch. Sie sind überrascht, dass ich Wei Hui und Mian Mian gelesen habe. Ich lächle mein erstes chinesisches Lächeln.
Schwedisches Wohnheim
Ich ziehe in ein schwedisches Wohnheim ein, meine Bettwäsche passt zufällig zum Überzug des Schreibtischstuhls. Sein altmodisches und irgendwie ekliges Grün sieht dadurch plötzlich nicht mehr altmodisch und eklig aus. Eher nach Frühling, denke ich. Ich bin etwas durchgequirlt und müde, Flugreisen gehen immer viel zu schnell. Ich meide die anderen Studenten, heute will ich keinen Wirbel mehr im Kopf, nur noch Ruhe. Keine Gespräche, kein holpriges Schwedisch, keine Staus, keine Flugzeuge, kein Geld ausgeben und kein Gepäck schleppen. Keine grinsenden Busfahrer, keine netten Flugbegleiterinnen und vor allem keine neugierigen Studentengesichter.
Vor meinem Fenster habe ich etwas, eine Aussicht, eine ganz passable Aussicht sogar. Ich sehe weiter als ich gewagt hatte zu hoffen, bis zu den Kuppeln des Reichsmuseums, bis zum Wald gegenüber, bis zum Mond. Als ich am Fenster stehe, sieht ein junger Mann zu mir hoch, ich stehe im Licht einer milchigen Nachttischlampe, üppige weiße Vorhänge links und rechts. Weil er schaut, sehe ich mich selbst am Fenster stehen. Als die Musik beginnt, fange ich beinah an zu weinen.